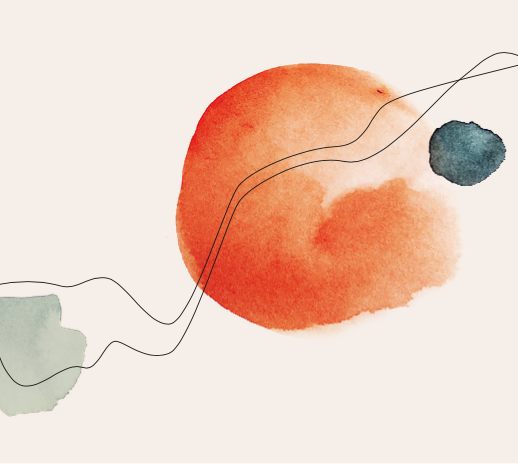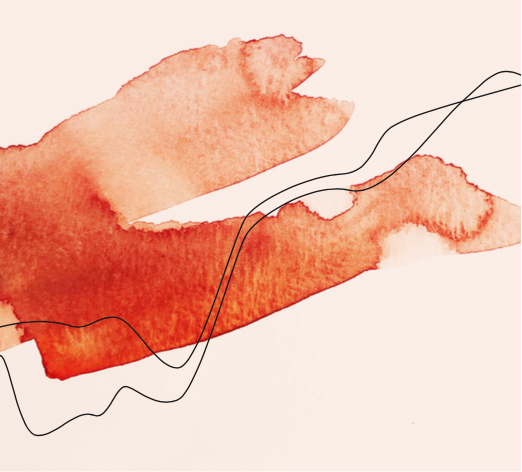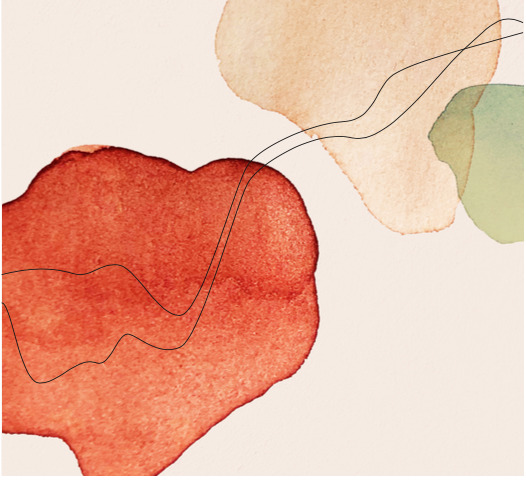Chaos stresst mich – und fasziniert mich. In dieser Folge geht es um das Bedürfnis nach Ordnung, die Angst vor Kontrollverlust und die Frage, warum viele in unsicheren Zeiten einfache Antworten suchen. Ich spreche über philosophische, gesellschaftliche und ganz praktische Perspektiven auf das Chaos – und darüber, was passiert, wenn wir lernen, es auszuhalten. Ist Chaos wirklich so schlecht, wie sein Ruf? Oder hat es vielleicht sogar seine eigene Ordnung?
Shownotes:
Macht [einen] Sinneswandel möglich, indem ihr Steady Fördermitglieder werdet. Finanziell unterstützen könnt ihr meine Arbeit auch via Paypal.me/sinneswandelpodcast. Danke.
► Arte Twist: Aufräumen – Macht Ordnung uns glücklich?, 2025
► Agora42: Ausgabe zu Chaos, 2025
► bpb: Rechtspopulismus: Erscheinungsformen, Ursachen und Gegenstrategien, 2017
► Studie: Understanding Societal Resilience—Cross-Sectional Study in Eight Countries, 2022
► Studie: Home and the extended-self: Exploring associations between clutter and wellbeing, 2021
►SXSW: Marie Kondo: Organize the World: Design Your Life to Spark Joy, 2017
►Spiegel: Aufräumexpertin Marie Kondo »Mein Zuhause ist unordentlich«, 2023
►Philosophie.ch: Chaos und Ordnung in Schellings Geschichtsphilosophie
► Philosophisches Experiment: Ist Chaos in Ordnung?
► SRF3: Chaos ist überlebenswichtig, 2022
► SWR: Was ist die Chaostheorie?, 2020
✉ redaktion@sinneswandel.art
► sinneswandel.art
Transkript:
Hi und herzlich willkommen im Sinneswandel Podcast. Ich bin Marielena und ich freue mich, dass ihr heute dabei seid.
Ich bin ehrlich gesagt ziemlich aufgeregt vor dieser Folge, während ich hier gerade vor dem Mikrofon sitze – was absurd ist, weil ich alleine bin. Aber ich möchte heute etwas ausprobieren, was ich schon sehr lange nicht mehr gemacht habe: komplett ohne Skript sprechen. Das klingt jetzt erst mal einfacher, als es ist. Aber ich habe den Podcast damals, vor acht Jahren, auch so begonnen – ohne Skript. Und irgendwann bin ich dazu übergegangen, alle meine Folgen zu skripten und aufzuschreiben.
Ich höre selber total gerne Podcasts, die nicht geskriptet sind. Also, beides hat sicherlich seine Vor- und Nachteile. Aber ich möchte das heute gerne mal wieder versuchen und schauen, was passiert, wenn ich es ausprobiere. Und ich dachte mir: Was gibt es für einen besseren Anlass, das auszuprobieren, als bei einer Folge, in der es um das Thema Chaos geht?
Da wären wir eigentlich schon beim Thema dieser Folge: Chaos.
Warum möchte ich eine Folge dazu aufnehmen? Chaos ist etwas, das mich – ja eigentlich mein Leben lang – begleitet, würde ich sagen. Oder vielleicht eher das Gegenteil von Chaos: nämlich Ordnung. Wer mich kennt, weiß, dass ich ein sehr ordnungsliebender Mensch bin – um es mal milde auszudrücken. Ich habe schon als Kind total gerne Dinge sortiert und geordnet – nicht zwanghaft, aber irgendwie hatte ich Freude daran. Das erzählen meine Eltern mir immer wieder. Und auch heute ist es so: Wenn Menschen in meine Wohnung kommen, dann höre ich oft: „Wow, mein Gott, ist das hier ordentlich und aufgeräumt und so minimalistisch.“ Und das ist total nett gemeint, aber mittlerweile ist mir das auch manchmal ein bisschen unangenehm. Ich weiß, dass ich sehr ordentlich bin. Ordnung gibt mir irgendwie Ruhe, beruhigt mich – und gibt mir natürlich auch ein Gefühl von Sicherheit. Im Außen zumindest, was sich dann irgendwie auf mein Inneres überträgt. Chaos im Außen macht mich eher unruhig und nervös. Gleichzeitig merke ich aber auch: Zu viel Ordnung kann einschränken. Es ist ja nicht nur die äußere Ordnung – sondern auch eine gewisse Strukturiertheit, ein Gefühl von Kontrolle. Und vermutlich habe ich eine Art Angst vor Kontrollverlust. Ich würde jetzt nicht so weit gehen, zu sagen, das wäre zwanghaft – aber ich mag es einfach, wenn eine gewisse Ordnung herrscht. Mein Computer ist zum Beispiel sehr aufgeräumt – auf meinem Desktop gibt es zwei, drei Ordner, die auch sortiert sind. Ich glaube, da gibt es einfach unterschiedliche Typen. Und ich bin eben einer dieser sehr geordneten Menschen. Damit habe ich mich mittlerweile abgefunden.
Trotzdem merke ich, dass mich das Thema begleitet – und dass ich mir manchmal wünsche, ein bisschen chaotischer und flexibler zu sein. Das ging so weit, dass ich vor ein paar Jahren mal darüber nachgedacht habe, mir das Wort „Chaos“ ganz klein irgendwo auf den Körper tätowieren zu lassen – als Erinnerung, es wieder mehr in mein Leben einzuladen. Ich habe es dann doch nicht gemacht. Aber das Thema hat mich nicht losgelassen. Ich verbringe auch gerne Zeit mit Menschen, die etwas „chaotischer“ sind als ich. Zum Beispiel bin ich gerade bei einem Freund, einem Künstler und Musiker. Er lebt in einem kreativen Chaos. Ich empfinde das gar nicht als unruhig – im Gegenteil: Ich verbringe sehr gerne Zeit hier. Ich könnte wahrscheinlich nicht dauerhaft so leben, aber wenn ich hier bin, empfinde ich sein Chaos als angenehm. Ich glaube, ich suche unterbewusst Menschen, die nicht so strukturiert sind wie ich – und das erinnert mich daran, das Chaos öfter in mein eigenes Leben einzuladen. Denn es bedeutet auch eine Form von Freiheit und Flexibilität.
So entstand auch die Idee zu dieser Folge – mit der Frage: Wie viel Ordnung brauchen wir eigentlich? Und ist Chaos wirklich so schlecht wie sein Ruf? Oder hat es vielleicht sogar seine eigene Ordnung?
Jetzt kann man sich natürlich fragen: Warum gerade jetzt dieses Thema? Wenn ich darüber nachdenke, womit ich Chaos und Ordnung verbinde, dann wird mir klar: Es ist nicht nur ein persönliches Thema. Es ist auch hochaktuell – hochpolitisch sogar. Denn wir leben in einer Welt, in der viele Krisen gleichzeitig stattfinden: Kriege, politische Unsicherheiten, wirtschaftliche Probleme, die Klimakrise… Viele Menschen erleben dadurch eine Art Kontrollverlust – eine große Unsicherheit, die in unser aller Leben tritt. Und das löst bei vielen Menschen Angst aus – vor der Zukunft, vor Veränderungen. Dinge, die früher als gesichert galten, bröckeln plötzlich. Und dieser Kontrollverlust führt bei vielen zu einem Wunsch nach Ordnung und Sicherheit. Ich habe letztens eine Doku auf Arte geschaut – „Twist“ heißt das Format, vielleicht kennt ihr das. Dort kam eine Aufräumexpertin und Influencerin zu Wort, Sabine Nietmann. Sie sagte: „Je chaotischer die Welt draußen ist, desto mehr habe ich den Drang, meine eigene Welt, meine vier Wände zu ordnen.“
Ich weiß nicht, ob ich das selbst schon mal so empfunden habe. Ich habe ja schon gesagt, dass ich grundsätzlich ein Bedürfnis nach Ordnung habe – aber ob das direkt mit der Weltlage zusammenhängt, kann ich schwer sagen. Aber es gibt viele Menschen, die reagieren auf äußeres Chaos mit einem verstärkten Wunsch nach Kontrolle. Sie wollen nicht nur ihre Wohnung ordnen, sondern auch die Welt – oder zumindest das Gefühl zurück, dass die Welt wieder berechenbar ist.
Viele populistische oder rechtsextreme Gruppen nutzen genau dieses Bedürfnis aus. Sie versprechen einfache Lösungen, wollen vermeintlich „wieder Ordnung schaffen“. Das sehen wir aktuell etwa bei Donald Trump in den USA, oder auch in Deutschland, wo rechtsextreme Kräfte mit Begriffen wie „Law and Order“ arbeiten. In unsicheren Zeiten wächst das Bedürfnis nach klaren Regeln und starker Führung – weil das Sicherheit verspricht. Diese Gruppen stellen sich als Retter der Ordnung dar und schieben gleichzeitig anderen – zum Beispiel Minderheiten oder Migrant*innen – die Schuld für das angebliche Chaos zu. Das ist gefährlich. Denn es entsteht der Eindruck: Wenn wir nur stark genug durchgreifen, wird alles wieder gut. Aber das ist eine Illusion. Und es blendet aus, dass Gesellschaften, die offen und vielfältig sind, langfristig krisenfester sind.
Ein Zitat, das ich in dem Zusammenhang sehr spannend finde, stammt von Frank Augustin, dem Herausgeber der Philosophiezeitschrift Agora42. Die letzte Ausgabe hatte passenderweise das Schwerpunktthema „Chaos“. Darin schreibt er:
„Der Mensch will Ordnung – aber keine Ordnung kann bleiben. Was man in Ordnung investiert, wird man früher oder später verlieren, weil nichts bleibt. Das Leben ist also sinnvoll und sinnlos zugleich. Damit gilt es, sich zu arrangieren. Manche – viele wohl – möchten sich damit aber nicht abfinden. Sie wollen nicht viele Ordnungen, die nebeneinander existieren, sondern eine Ordnung. Aber wer bleibenden Sinn will, bekommt maximalen Sinnverlust.“
Ich finde, das bringt es sehr gut auf den Punkt. Wir sehnen uns nach festen Bedeutungen, nach Ordnung – das ist zutiefst menschlich. Aber: Die Realität ist oft chaotisch. Und je mehr wir versuchen, alles unter Kontrolle zu bringen, desto eher erleben wir Überforderung oder Frustration.
Was ich mich frage: Warum hat Chaos eigentlich so einen schlechten Ruf? Warum gilt Ordnung als gesellschaftliches Ideal – als Norm – während Chaos eher als etwas gilt, das vermieden werden muss?
Es gibt ja diesen Spruch: „Ordnung ist das halbe Leben“. Ich weiß nicht, ob es das auch in anderen Kulturen gibt – aber es klingt für mich ziemlich „kartoffelig deutsch“. Trotzdem trifft es in Teilen auch auf mein Leben zu. Vielleicht, weil ich so sozialisiert wurde. Tatsächlich zeigen Studien, dass sich viele Menschen wohler fühlen, wenn ihre Umgebung ordentlich ist. Sie sind entspannter, produktiver. Ein aufgeräumter Arbeitsplatz oder ein minimalistisches Zuhause kann den Kopf freier machen – hilft beim Fokussieren. In der gleichen Arte-Doku sagt Sabine Nietmann: “Wenn man Dinge ordnet in seinem Leben, fängt man auch häufig an, zu hinterfragen: Welche Entscheidungen waren richtig? Da fließen manchmal auch Tränen. Also dieses Ordnen und Aufräumen im eigenen Leben hat etwas Therapeutisches.”
Ich glaube, viele von uns haben das schon erlebt: Beim Ausmisten von alten Gegenständen oder Erinnerungsstücken tauchen plötzlich Gefühle auf, Fragen, Erinnerungen. Es ist also mehr als nur eine saubere Wohnung – es ist eine Auseinandersetzung mit uns selbst. Aber Ordnung kann auch Druck machen. Gerade in sozialen Medien, zum Beispiel im Trend der „Clean Girl Aesthetic“ – wo vor allem junge Frauen sich selbst und ihre Wohnungen besonders clean, aufgeräumt, ästhetisch zeigen. Immer alles in Beige, mit frischen Blumen, Yogamatte und glattem Haar. Was auf den ersten Blick beruhigend wirkt, kann schnell ins Normative kippen. Denn Unordnung wird dort kaum gezeigt – und wenn doch, dann maximal inszeniert. Und das kann dazu führen, dass Menschen sich schämen, wenn ihre Wohnung nicht so aussieht. Ich kenne auch Freund*innen, die sagen: „Ich bin so ein chaotischer Mensch, ich wäre gerne ordentlicher.“ Das zeigt, wie tief Ordnung mit unserer Sozialisation und unseren gesellschaftlichen Erwartungen verknüpft ist. Vor allem an Frauen werden oft noch immer andere Maßstäbe gelegt: schon als Mädchen wird ihnen beigebracht, für Sauberkeit und Ordnung zuständig zu sein. Das ist wichtig zu erkennen: Ordnung ist nicht neutral. Sie ist auch ein kulturelles und soziales Konstrukt – geprägt von Erziehung, Rollenbildern, gesellschaftlichem Druck. Und sie kann ein Ausdruck von Privilegien sein: Wer hat überhaupt Zeit und Raum, um aufzuräumen? Und selbst Ordnungsgurus wie Marie Kondo haben mittlerweile ihre Haltung überdacht. Sie sagte kürzlich in einem Interview, dass sie mit drei Kindern nun deutlich weniger aufräumt – und das ganz bewusst. Weil sie erkannt hat, dass ein bisschen Chaos auch zum Leben dazugehört.
Und damit kommen wir eigentlich zur Kernfrage dieser Folge: Damit Ordnung entstehen kann – braucht es dafür nicht vielleicht sogar erst einmal Chaos?
Ich habe mir dazu angeschaut, woher das Wort „Chaos“ eigentlich kommt. Wie so viele Begriffe stammt es aus dem Altgriechischen – und bedeutet ursprünglich so etwas wie „gähnende Leere“. Aber diese Leere war kein Nichts. In der Antike wurde Chaos vielmehr als Urzustand verstanden, aus dem alles hervorgeht. Also: Chaos als Ursprung von Ordnung, Leben, Welt. Der Philosoph Friedrich Schelling hat das ebenfalls so beschrieben. Er schreibt, dass zu Beginn das Chaos stand – alles war durcheinander – und erst danach kam Ordnung, auch die gesellschaftliche. Doch selbst wenn Ordnung geschaffen wird: Ein Rest Chaos bleibt immer bestehen. Und das ist vielleicht sogar gut so. Noch weiter gehen Philosophen wie Nietzsche oder Heidegger. Für sie ist Chaos nicht das Gegenteil von Ordnung. Nicht dieses bipolare Denken: gut oder schlecht. Sondern: Chaos hat eine eigene Kraft. Es ist die Voraussetzung für Erkenntnis, für Freiheit. Ohne Chaos keine neuen Gedanken. Keine Ideen.
Ich finde das total einleuchtend. Wenn ich an meinen Künstlerfreund denke, in dessen Wohnung ich die Folge aufgenommen habe – dann habe ich das Gefühl, dass sein kreatives Chaos ihn inspiriert. Dass es Raum schafft für das Unerwartete. Und auch wenn wir selbst Ideen entwickeln, brainstormen oder schreiben – dann geht das oft nur, wenn wir uns zunächst dem Ungeordneten aussetzen. Später kommt dann Struktur dazu. Aber am Anfang braucht es Offenheit. Und genau das kann Chaos ermöglichen.
Tatsächlich gibt es auch Studien, die zeigen, dass unordentliche Räume originellere Ideen fördern. Sie regen an, Konventionen zu hinterfragen, weil das gewohnte Umfeld durchbrochen wird. Natürlich steht das im Widerspruch zu den Studien, die Ordnung mit Produktivität und Wohlbefinden in Verbindung bringen. Aber genau das ist ja das Spannende: Beide Perspektiven haben ihre Berechtigung. Ordnung und Chaos schließen sich nicht aus. Sie sind zwei Pole, zwischen denen wir uns bewegen – vielleicht sogar bewegen müssen. Und: Wer lernt, sich in unsicheren Situationen zurechtzufinden – also Chaos auszuhalten – trainiert seine eigene Resilienz. In einer Welt, die sich ständig wandelt, ist das Gold wert.
Wenn man in die Natur blickt, kann man das gut beobachten. Kein Ökosystem ist dauerhaft „in Ordnung“ – im Sinne von statisch. Alles ist im Fluss: Pflanzen, Tiere, Wetter, Klima. Alles reagiert auf Veränderungen, passt sich an, verändert sich. Die sogenannte Chaostheorie beschäftigt sich genau damit: dass Systeme, die auf den ersten Blick unberechenbar wirken, dennoch eigenen Gesetzmäßigkeiten folgen. Und dass selbst kleinste Veränderungen – wie der berühmte Flügelschlag eines Schmetterlings – riesige Auswirkungen haben können. Das Chaos hat also eine eigene innere Ordnung – auch wenn wir sie nicht immer sofort erkennen.
Ich hoffe, ihr konntet meinen Gedanken bis hierher folgen. Ich bin selbst ein bisschen überrascht, dass das freie Sprechen doch ganz gut funktioniert hat. Zum Abschluss möchte ich noch teilen, was mir persönlich hilft, mehr Chaos in meinem Leben zuzulassen – und dadurch innerlich gelassener und flexibler zu werden.
Erstens: Akzeptanz. Das klingt banal, ist aber zentral. Immer wieder bewusst zu machen, dass nicht alles planbar ist. Dass Leben auch bedeutet, mit Unvorhergesehenem umzugehen. Dass ich nicht alles kontrollieren kann – und auch nicht muss. Zweitens: Selbstvertrauen. Wenn ich zurückschaue, merke ich, dass viele gute Dinge in meinem Leben passiert sind, obwohl – oder gerade weil – sie nicht geplant waren. Das hilft mir, dem Leben mehr zu vertrauen. Drittens – und das ist fast ein bisschen absurd, aber sehr wirksam: Ich übe, Dinge nicht wegzuräumen. Das klingt jetzt albern, aber wenn man so ordnungsliebend ist wie ich, dann ist das echt eine Übung. Ich lasse bewusst mal was stehen. Nicht immer, aber immer öfter. Und das hilft. Auch im Zusammenleben mit anderen. Am Ende glaube ich: Chaos und Ordnung sind individuell. Meine Ordnung ist nicht deine Ordnung. Und das ist okay. Ordnung ist auch eine Stärke –
Outro
Ich bin sehr gespannt, wie ihr diese Folge erlebt habt. War sie für euch zu chaotisch – oder eher befreiend? Fehlt euch das Skript? Oder denkt ihr: Da geht noch mehr Chaos?
Schreibt mir gerne an redaktion@sinneswandel.art oder über Social Media. In den Shownotes findet ihr wie immer weiterführende Links und Infos. Und wenn ihr meine Arbeit unterstützen wollt, dann könnt ihr das ganz einfach via Steady oder, indem ihr einen Betrag eurer Wahl an Paypal.me/Sinneswandelpodcast schickt. Danke fürs Zuhören. Ich wünsche euch einen schönen – vielleicht sogar leicht chaotischen – Tag.