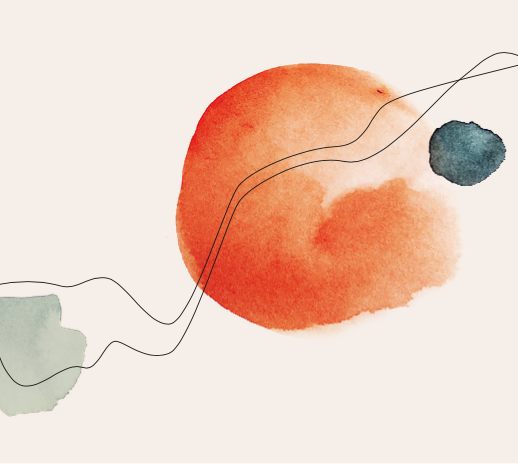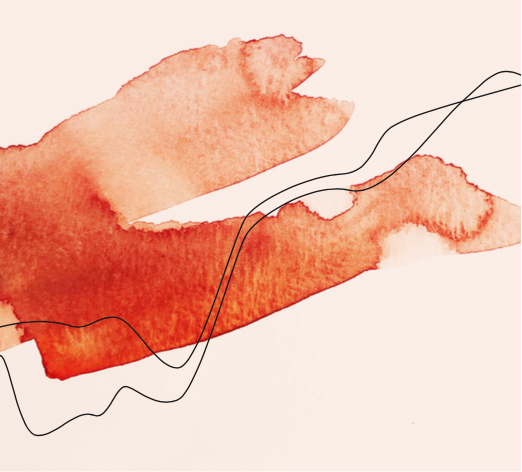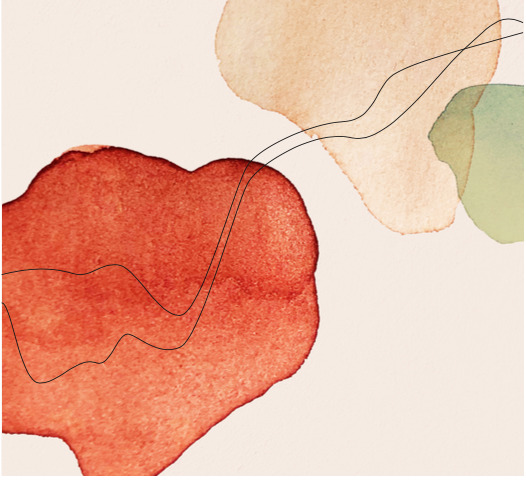„Kunst ist die einzige Kraft, die die Menschheit von jeglicher Unterdrückung befreit“, so der Künstler Joseph Beuys. Dabei wollte er die Kunst keinesfalls auf das Schwingen eines Pinsels reduziert wissen. Für Beuys war sie weitaus mehr: Kunst, als die Grundlage allen Gestaltens und damit auch das der Gesellschaft, wenn man sie als “soziale Plastik” begriff. Angesichts Beuys 100. Geburtstag, der in diesem Jahr stattgefunden hätte, wollen wir sein Denken und Schaffen in die Gegenwart holen. Was macht Beuys auch, oder gerade heute aktuell? Wir sprechen u.a. mit Menschen, die Beuys persönlich kannten, genauso, wie mit Künstler*innen, die im weitesten Sinne in seine Fußstapfen treten. Den Anfang des Beuys-Spezials macht Bettina Paust, Leiterin des Wuppertaler Kulturbüros und davor langjährige künstlerische Direktorin des Joseph Beuys Archivs Schloss Moylands.
Shownotes:
Macht (einen) Sinneswandel möglich, indem ihr Fördermitglieder werdet. Finanziell unterstützen könnt ihr uns auch via PayPal oder per Überweisung an DE95110101002967798319. Danke.
► beuys2021: Programm und Infos.
► Utopiastadt: Zukunftsort und Kreativprojekt in Wuppertal.
► Joseph Beuys-Handbuch – Leben Werk Wirkung erscheint im Juli 2021 im metzler Verlag.
► Wuppertaler Performance Festival im Rahmen von beuys2021.