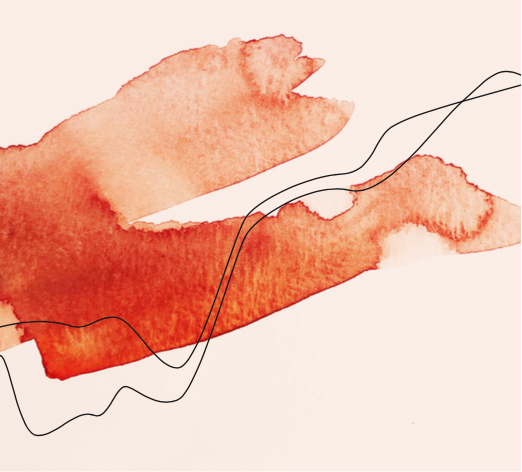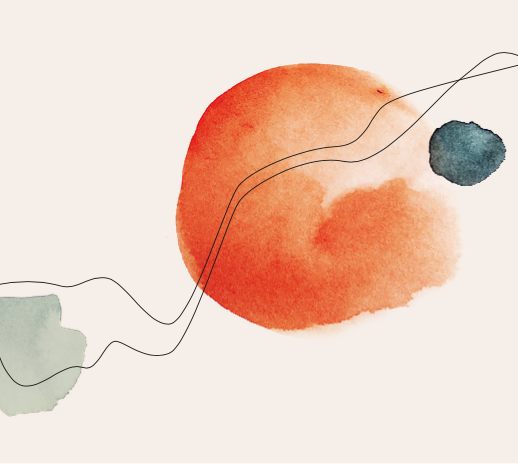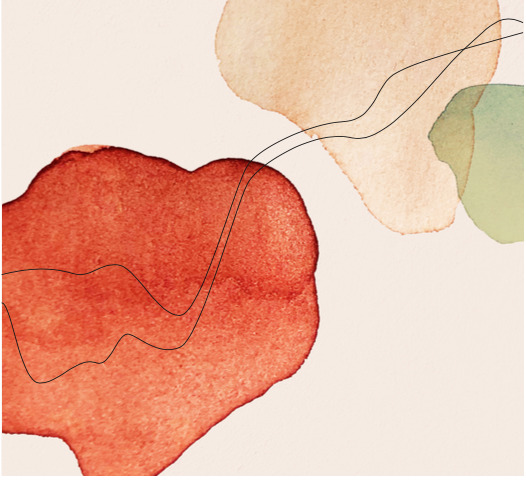In unsicheren Zeiten wächst die Sehnsucht nach Einfachheit und Entweder-oder-Denken. Das ist verständlich, aber nicht zeitgemäß, argumentiert die Philosophin Rebekka Reinhard. Unsere Vernunft wach zu machen und offen zu sein für das Vieldeutige und Widersprüchliche, weitet unseren Blick für andere Möglichkeiten – und für Reichtum und Schönheit einer vielfältigen Welt. Das »wache Denken« begegnet der Vereinfachung mit einer Lust am Spiel, am Experiment, am Wagemut. Und das brauchen wir, laut Rebekka Reinhard, heute dringend, um zu neuem Wissen zu finden, zu einer intelligenten Verbindung von Verstand und Emotion, von Hirn und Herz.
Shownotes:
► Wach Denken: Für einen zeitgemäßen Vernunftgebrauch von Rebekka Reinhard. Erschienen 09/2020 im Verlag der Körber Stiftung.
► Mehr von und über Rebekka Reinhard auf ihrer Website.
Macht (einen) Sinneswandel möglich, indem ihr Fördermitglieder werdet. Finanziell unterstützen könnt ihr uns auch via PayPal oder per Überweisung an DE95110101002967798319. Danke.
Kontakt:
✉ redaktion@sinneswandel.art
► sinneswandel.art