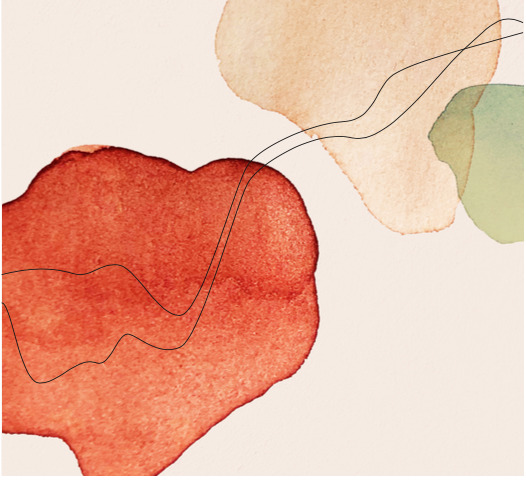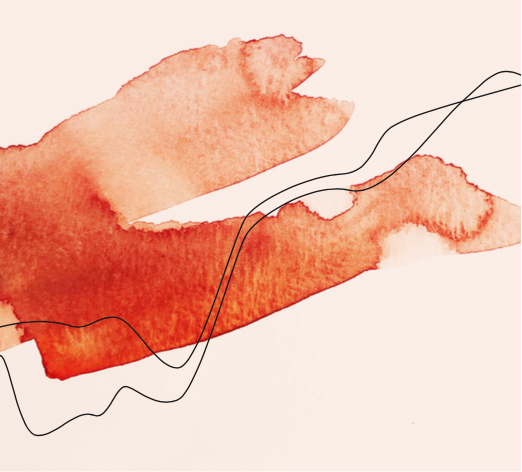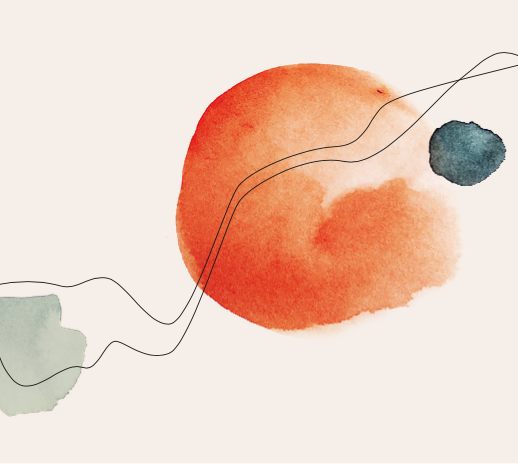Die alte Zukunft hat keine Zukunft. Und doch scheinen wir sie uns nicht einmal vorstellen zu können – eine bessere Zukunft. Wir lobpreisen die Gegenwart, die Achtsamkeit des Augenblicks – doch wären wir uns wirklich selbst so bewusst, wie wir vorgeben zu sein, müssten wir dann nicht erkennen, dass die Gegenwart nicht zukunftsfähig ist?! Wie kann es sein, dass bis heute, trotz des exponentiellen Anstiegs an Informationen, aus all den Fakten keine Praxis entsprungen ist? Und doch kopieren wir immer wieder das, was wir bereits kennen – aus Angst vor der Zukunft?
Shownotes:
Macht (einen) Sinneswandel möglich, indem ihr Fördermitglieder werdet. Finanziell unterstützen könnt ihr uns auch via PayPal oder per Überweisung an DE95110101002967798319. Danke.
Danke auch an Jonte Mutert, der unseren neuen Jingle produziert hat. Sowie an Hannes Wienert, der uns seine Stimme für die Zitate von Roger Willemsen lieh.
► Roger Willemsen: “Wer wir waren” (2016).
► Springer: “The development of episodic future thinking in middle childhood”(2018).
► PNAS: “Reducing future fears by suppressing the brain mechanisms underlying episodic simulation”(2016).
► Frankfurter Rundschau: “Historisches Urteil zur Klimaklage: Jetzt müssen die Emissionen so schnell wie möglich runter”, (05/2021).
► Dietmar Dath: “Niegeschichte. Science Fiction als Kunst- und Denkmaschine”, Matthes & Seitz. Berlin (2019).
► Ernst Bloch: “Geist der Utopie”, Suhrkamp (1918).
Kontakt:
✉ redaktion@sinneswandel.art
► sinneswandel.art
Transkript: Zukunft, (un)denkbar? – Können wir uns ein besseres Morgen vorstellen?
Hallo und herzlich willkommen im Sinneswandel Podcast. Mein Name ist Marilena Berends und ich freue mich, euch in der heutigen Episode zu begrüßen.
Es ist Zeit für einen Wandel! Das haben wir uns auch in der Podcast Redaktion gedacht, und daher vor einigen Wochen einen Aufruf gestartet, in dem wir euch gebeten haben, uns eure Vorschläge für einen neuen Sinneswandel Jingle zu schicken. Vielen Dank an alle, die das getan haben. Wir sind wirklich überwältigt von der Vielfalt an Ergebnissen und davon, wie viel Zeit und Mühe ihr in die Produktion gesteckt habt. Die Auswahl ist uns alles andere als leicht gefallen – aber, wie ihr vermutlich schon gehört habt, ist sie gefallen. Der neue Jingle kommt von Jonte Mutert, der noch in diesem Jahr sein Studium der Filmmusik in Babelsberg aufnehmen wird. Wir hoffen, euch gefällt der neue Sound ebenso gut, wie uns. Schickt uns gern euer Feedback an redaktion@sinneswandel.art.
Um Wandel soll es auch in der heutigen Episode gehen. Oder vielmehr darum, welches Denken die Realisation von Wandel voraussetzt. Bevor wir beginnen, möchte ich noch kurz darauf hinweisen, dass wir uns freuen, wenn ihr unsere Arbeit finanziell unterstützt. Bereits 200 Fördermitglieder zählen wir auf Steady – was großartig ist und wofür wir sehr dankbar sind – damit wir aber weiterhin und vor allem langfristig möglichst unabhängig produzieren können, seid ihr gefragt! Unterstützen könnt ihr uns, wie gesagt ganz einfach mit einer Mitgliedschaft über Steady oder auch, indem ihr uns einen Betrag eurer Wahl an Paypal.me/SinneswandelPodcast schickt – das geht auch schon ab 1€ und steht alles noch mal in den Shownotes. Das war’s, ich wünsche euch viel Freude beim Zuhören!
“Mag die Welt auch vor die Hunde gehen, die Zukunft hat dennoch ein blendendes Image”, schreibt Publizist Roger Willemsen in “Wer wir waren”, der letzten Rede vor seinem viel zu frühen Tod im Februar 2016. “Selbst verkitscht zu Wahlkampf-Parolen, verkauft sie sich so gut, als wäre sie wirklich noch ein Versprechen”. So warb Armin Laschet in seiner Rede für das CDU-Programm zur Bundestagswahl mit einem „Jahrzehnt der Modernisierung“ und die Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock, sprach auf dem Grünen-Parteitag davon, dass eine Ära zu Ende gehe und wir nun die Chance hätten, eine neue zu begründen. Jetzt sei der Moment, unser Land zu erneuern, so Baerbock. Doch längst nicht nur die Politik hat die Zukunft für sich entdeckt. So warb die niederländische Versandapotheke Doc Morris 2018 mit “Gestalten wir die Zukunft, bevor sie da ist“, einem Slogan, der ebenso gut von einer Partei hätte kommen können. Zukunft ist längst nichts mehr, das einfach passiert. Nicht umsonst zerbrechen sich Zukunftsforscher*innen an renommierten Instituten die Köpfe darüber, in welcher Welt wir einmal leben werden. Das Morgen wird schon heute vorausgedacht.
Man könnte also den Eindruck gewinnen, die Zukunft stehe vor der Tür. Dabei könnten wir kaum weiter von ihr entfernt sein. Vielmehr stehen wir vor dem Abgrund einer ganz und gar ungewissen Zukunft, was wir nur zu verdrängen scheinen. “Die Zukunft, das ist unser röhrender Hirsch über dem Sofa, ein Kitsch, vollgesogen mit rührender Sehnsucht und Schwindel. Die Zukunft der Plakate existiert losgelöst von den Prognosen unseres Niedergangs und hat in der Kraft ihrer Ignoranz keinen Bewegungsspielraum, sie verharrt hingegen. Was nicht neu ist, das ist die Zukunft”, so Willemsens These. Dabei wissen wir doch eigentlich schon lange, dass es nicht mehr weitergehen kann wie bisher. Und doch kopieren wir immer wieder das, was wir bereits kennen, und pflegen eine nostalgische Beziehung zur Vergangenheit – aus Angst vor der Zukunft? “Where is the wisdom we lost in knowledge?”, fragt T.S. Eliot bereits 1934 in seinem Theaterstück “The Rock”. Wie kann es sein, dass bis heute, trotz des exponentiellen Anstiegs an Informationen, aus all den Fakten keine Praxis entsprungen ist? Ist es das schlechte Gewissen gegenüber künftigen Generationen, was uns schließlich handeln lässt? Oder bedarf es erst der Justiz, die uns ermahnt, die Zukunft mitzudenken? Es bleibt noch abzuwarten, ob auf das erst kürzlich im April getroffene Urteil des Bundesverfassungsgerichts, demzufolge das Klimaschutzgesetz in Teilen verfassungswidrig sei, sprich nicht mit den Grundrechten vereinbar, die gewünschte Umsetzung folgen wird. Als “Zeitenwende. Bahnbrechend. Und wirklich historisch”, bezeichnete Energieökonomin Claudia Kemfert das Urteil. Denn zum ersten Mal wird auf oberster Ebene Generationengerechtigkeit in puncto Klima juristisch mitgedacht. Worauf sich Karlsruhe dabei beruft, ist das sogenannte Vorsorgeprinzip des Staates laut Grundgesetz Artikel 20a, demzufolge die Regierung verpflichtet ist künftige Generationen vor dem Klimawandel zu schützen und Kosten nicht unnötig auf unsere Enkelkinder schieben darf. Das Urteil konsequent zu Ende gedacht bedeutet: Rasches Handeln ist erforderlich. Nichtstun oder einfach so weitermachen wie bisher, ist deutlich teurer als endlich zu Handeln. Die wahre Schuldenbremse, so Kemfert, sei der Klimaschutz. Was jetzt passieren muss, sei eine 180 Grad Wende: Raus aus dem fossilen Zeitalter und grünes Licht für die erneuerbaren Energien! Wachstum allein, ist längst kein Indikator mehr für Wohlstand und Zufriedenheit – war es vermutlich nie. Was nun zählt, ist Wachstum enkeltauglich zu gestalten. Wachstum, um des Wachstums Willen, das ist ein Relikt der Vergangenheit!
Die alte Zukunft hat keine Zukunft. Und doch scheinen wir sie uns nicht einmal vorstellen zu können, eine bessere Zukunft. Wir lobpreisen die Gegenwart, die Achtsamkeit des Augenblicks – doch wären wir uns wirklich selbst so bewusst, wie wir vorgeben zu sein, müssten wir dann nicht erkennen, dass die Gegenwart nicht zukunftsfähig ist?! “Wir waren jene, die wussten, aber nicht verstanden, […] randvoll mit Wissen, aber mager an Erfahrung. […] Wir waren die, die verschwanden. […] So bewegten wir uns in die Zukunft des Futurums II: Ich werde gewesen sein.” So lautet zumindest Roger Willemsens wenig hoffnungsvolle Vision.
Dabei ist die Zukunft im Kopf durchzuspielen eine zentrale menschliche Fähigkeit, die unser alltägliches Handeln bestimmt. Selbst kleinste Entscheidungen treffen wir, indem wir im Geiste simulieren, was passieren könnte. Etwa wenn wir morgens beim Bäcker an der Theke stehen und uns fragen, ob wir lieber das Schoko-Croissant oder doch das belegte Dinkelbrötchen wählen sollten. “Zukunftsdenken hilft uns, Ziele zu setzen und zu planen, und gibt uns die Motivation, unsere Pläne auch umzusetzen”, sagt Roland Benoit, Kognitions- und Neurowissenschaftler am Max-Planck-Institut in Leipzig. Forscher*innen gehen davon aus, dass wir bereits im Alter von drei bis fünf Jahren beginnen, über den gegenwärtigen Moment hinaus, in die Zukunft zu denken. Eine besondere Rolle dabei spielt ein Netzwerk, das aus dem Hippocampus und Teilen der Großhirnrinde besteht. Es überlappt sich mit dem sogenannten “Default Mode Network”, also dem Ruhezustandsnetzwerk, das immer dann aktiv wird, wenn wir gerade nichts zu tun haben. Was, wenn wir ehrlich sind, angesichts all der Ablenkungen und Reize unserer vernetzen und schnelllebigen Welt, nur noch allzu selten vorkommt. Im Zeitalter der Zerstreuung seien wir, so Willemsen, nie ganz in der Gegenwart. Auch die Zukunft sei uns damit abhanden gekommen, nur noch rein gegenständlich vorstellbar und reduziert auf Technikutopien, die uns Menschen mehr entmündigten, als befreiten. “Verstand sich der Mensch Anfang des 20. Jahrhunderts eher als Subjekt der Moderne, erkennt er sich hundert Jahre später eher als ihr Objekt. Wie aber soll er, von der Zeit vorangeschoben, unter diesen Bedingungen die Zukunft denken können?”
Sind wir also, angetrieben durch Effizienzstreben und Wachstumsdrang, defacto zu bequem geworden, uns eine andere Welt, als die bereits Existierende, vorzustellen? Ist dies der Grund, weshalb wir uns schon mit kleinsten Updates zufriedengeben, uns gar euphorisch in die Warteschlange einreihen, wenn die x-te Version des “neuen” iPhones auf dem Markt erscheint? Dabei sollte die Postmoderne doch eigentlich die Moderne ablösen, indem sie ihr zu mehr Vielfalt und Kritik verhilft. “Mehr Demokratie wagen.” Weg von Funktionalität, hin zum kreativen Chaos. Stattdessen scheinen wir gefangen in einer Welt des Machbaren, anstelle des Wünschbaren. Hitzig wird über die Erhöhung von Benzinpreisen diskutiert, die Arm und Reich, so heißt es, weiter werden spalten. Die Zukunft muss mehrheitsfähig sein, um Zukunft zu haben.
Vielleicht ist es aber auch ein menschlicher “Gen-Deffekt”, ganz einfach Teil unserer menschlichen Natur, dass wir uns die Zukunft nicht vorstellen, sie nicht anders denken können? Werfen wir einen Blick zurück in die Geschichte, so könnte dieser Eindruck durchaus verstärkt werden: “Das Auto hat keine Zukunft. Ich setze auf das Pferd”, verkündete Kaiser Wilhelm II. 1904 stolz. Auch Wilbur Wright, ein Pionier der Luftfahrt, sollte sich irren, als er 1901 sprach: “Der Mensch wird es in den nächsten 50 Jahren nicht schaffen, sich mit einem Metallflugzeug in die Luft zu erheben”. Ebenso, wie im Jahre 1926 Lee De Forest, der Erfinder des Radios: “Auf das Fernsehen sollten wir keine Träume vergeuden, weil es sich einfach nicht finanzieren lässt.” Und auch Thomas Watson, CEO von IBM, konnte sich 1943 scheinbar noch nicht die Welt von heute vorstellen: “Ich denke, dass es einen Weltmarkt für vielleicht fünf Computer gibt. Es gibt keinen Grund, warum jeder einen Computer zu Hause haben sollte.” Die Liste menschlicher Irrungen ließe sich beliebig weiterführen, und es scheint beinahe, als sei der Mensch dort am altmodischsten, wo er versucht, sich selbst zu überschreiten. Offenbar können wir uns selbst nicht entkommen.
Im Jahr 2016 fanden Neurowissenschaftler*innen des Leipziger Max-Planck-Instituts, gemeinsam mit britischen Kollegen, allerdings heraus, dass es manchmal sogar ratsam sein kann, Zukunftsgedanken zu unterdrücken. Eine Überlebensstrategie gewissermaßen. Die Forscher*innen ließen Probanden zukünftige Szenarien auflisten, die ihnen Sorgen bereiteten. Wer sich diese anschließend im Geiste vorstellen sollte, reagierte deutlich ängstlicher als Teilnehmende, die Gedanken an die negativen Ereignisse bewusst vermieden. Es macht demnach für unsere emotionale und kognitive Grundhaltung, wie auch für unsere Entscheidungen und Handlungspläne, einen großen Unterschied, ob wir mit negativen Vorahnungen in die Zukunft blicken, oder Positiv-Szenarien im Kopf entwerfen. Damit Letztere jedoch nicht in der “Utopien-Schublade” verstauben, benötigt unser Gehirn ein „Wie“ und ein „Warum“. Die Verortung der eigenen Rolle in der mentalen Simulation, lässt die Zukunft für uns zu einem Möglichkeitsraum werden, in dem wir selbst eine gestalterische Rolle einnehmen. Fühlen wir uns handlungsfähig, lässt der Eindruck nach, von den Ereignissen überrollt zu werden. Ohne aktive kognitive Beteiligung und ein Gefühl von Selbstwirksamkeit, schauen wir hingegen nur passiv vom Zuschauerrand zu. Es ist die emotionale Färbung, die unseren Ausblick auf die Zukunft, aber auch unser Erleben in der Gegenwart bestimmt. Und wie wir wissen, geschieht die Weichenstellung für die Zukunft im Hier und Jetzt.
Science-Fiction ist eigentlich das beste Beispiel dafür, dass es funktioniert. Dass wir Menschen in der Lage sind, uns das schier Unmögliche vorzustellen. Weshalb, das hat Schriftsteller Dietmar Dath in seinem Buch “Niegeschichte” sehr treffend formuliert: „Es gibt nicht nur Dinge, die zwar denkbar sind, aber nicht wirklich, sondern umgekehrt auch solche, die wirklich sind, aber für Menschen schwer bis überhaupt nicht denkbar.“ Science-Fiction zeigt: Was undenkbar ist, muss noch lange nicht unmöglich sein. Das klingt abstrakt, aber abstrakt ist schließlich auch unser Verhältnis zur Welt, in der wir leben. Wer hätte sich vor kurzem schon vorstellen können, dass ein klitzekleines, kronenförmiges Virus das gesamte soziale Leben einmal lahmlegen würde?
“Nur Zeiten, die viel zu wünschen übrig lassen, sind auch stark im Visionären”, schreibt Roger Willemsen. Hat die Corona-Pandemie, als Zeit der Entbehrung, also vielleicht ein Fenster geöffnet, einen Raum für das Visionäre geschaffen – gar für einen Neuanfang? So oder so, ist jetzt die richtige Zeit, oder vielmehr die letzte Chance, die wir noch haben, um das Neu- und Andersdenken von Zukunft wieder zu erlernen. Wenn es nach dem Schriftsteller Ernst Bloch geht, so sind es Bilder und Fantasien, die den Gedanken vorausgehen, und die Gedanken wiederum den Forderungen und der politischen Praxis. Indem wir uns das Morgen ausmalen, erkennen wir, wo es in der Gegenwart hakt. Die Utopie ist das Hinausgehen über die faktische Welt und auch, wenn sie reine Projektion bleibt, hat allein der Diskurs, der durch das Imaginieren entsteht, die Welt und wie wir sie wahrnehmen, bereits verändert. Denn im offenen Dialog und in immer neuen Selbst-und Weltbeschreibungen werden Vorstellungen vom gelungenen Leben zur Diskussion gestellt. Und dort, wo Entwürfe wünschenswerter Zukünfte entwickelt werden, beginnt auch ihre Realisation. Oder mit Roger Willemsens Worten: “Ja, die Zukunft wird schneller sein, und sie hat längst begonnen.”
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt, teilt ihn gerne mit Freunden oder hinterlasst uns eine positive Bewertung auf iTunes. Und, wie gesagt, freuen wir uns besonders, wenn ihr unsere Arbeit als Fördermitglieder unterstützt, damit wir weiterhin für euch produzieren können. Supporten könnt ihr uns ganz einfach via Steady oder, indem ihr uns einen Betrag eurer Wahl an Paypal.me/Sinneswandelpodcast schickt. Alle weiteren Infos und Quellen zur Episode findet ihr, wie immer, in den Shownotes. Vielen Dank und bis bald im Sinneswandel Podcast.